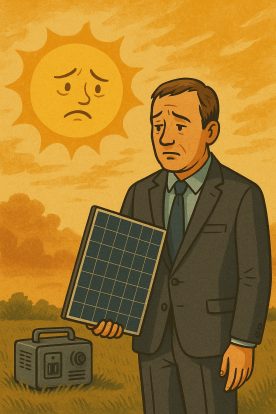
In einem aktuellen Urteil des Landgerichts Köln (Az. 31 O 11/24 (Kart), nicht rechtskräftig) wurde der Versuch, durch haltlose kartellrechtliche Vorwürfe eine Wettbewerberin wirtschaftlich unter Druck zu setzen und zur Preisgabe interner Informationen zu bewegen, deutlich zurückgewiesen.
Hintergrund des Verfahrens
Im Zentrum des Verfahrens standen sogenannte Balkonkraftwerke – kompakte Photovoltaikanlagen für den Heimgebrauch. Beide Parteien bieten solche Systeme im Komplettpaket an. Streitpunkt waren Wechselrichter eines asiatischen Markenherstellers, die sich aufgrund ihrer technischen Leistungsmerkmale besonderer Nachfrage erfreuen.
Die unterlegene Partei warf der Gegenseite vor, durch angebliche Preisabsprachen mit dem Hersteller sowie durch die gezielte Zurückhaltung von Lieferungen eine marktbeherrschende Stellung auszunutzen. Ferner machte sie weitreichende Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz geltend – mit Verweis auf eine Zoom-Konferenz und interne Preiskommunikation.
Ziel war es offensichtlich, unter dem Deckmantel des Kartellrechts an umfassende interne Geschäftsgeheimnisse zu gelangen.
Klare Worte des Landgerichts Köln
Das Landgericht Köln ließ sich davon nicht überzeugen. Es stellte vielmehr fest, dass die Vorwürfe völlig haltlos waren.
- Keine Marktbeherrschung: Eine marktbeherrschende Stellung war nicht ansatzweise dargelegt. Der relevante Markt sei nicht auf Deutschland beschränkt – Händler in ganz Europa seien aktiv. Zudem habe die Klägerin jederzeit die Möglichkeit gehabt, direkt beim Hersteller zu bestellen.
- Keine Preisabsprache: Die Kommunikation über sogenannte „reference prices“ sei als zulässige Preisempfehlung einzustufen. Die Teilnahme an einer Zoom-Konferenz mit dem Hersteller begründe noch keinen Kartellverstoß – auch weil kein Druck zur Umsetzung konkreter Preismodelle ausgeübt wurde.
- Keine Grundlage für Schadensersatz (und Auskunft): Für einen kausalen Schaden durch die angeblichen Absprachen fehlte es an jeglicher belastbarer Darlegung. Die eigene Entscheidung, Produkte weiterhin zu beziehen, obwohl man von der behaupteten Wettbewerbswidrigkeit wusste, untergrabe zudem die Plausibilität des Vorbringens. Daher war auch die Forderung nach Auskunft haltlos.
Anspruchsabwehr kann teuer werden – Kostenfolgen bei Streitwert von 1 Mio. €
Das Urteil macht deutlich, wie riskant es sein kann, unbegründete Ansprüche zu erheben.
Das Gericht setzte den Streitwert auf 1.000.000 € fest – was bei vollständigem Unterliegen der Anspruchstellerin zu folgenden finanziellen Konsequenzen führt:
- Gerichtskosten: ca. 16.500 €
- Rechtsanwaltskosten für beide Seiten: jeweils ca. 18.000 €
→ Gesamtkostenbelastung der unterlegenen Partei: über 52.000 €
In einer Branche, die sich „Nachhaltigkeit“ und „Verantwortung“ auf die Fahne schreibt, wirkt ein solches Vorgehen umso widersprüchlicher.
Parallelen zu unlauteren Leistungsversprechen
Das Urteil reiht sich ein in eine Reihe kartell- und wettbewerbsrechtlicher Auseinandersetzungen, die die vorgeblich ideologisch saubere Solarbranche zunehmend prägen. Bereits in einem früheren Beitrag zu falschen Leistungsangaben bei Solarmodulen wurde deutlich, dass technische Greenwashing-Strategien und wirtschaftlicher Druck im Solarsektor kein Einzelfall sind:
Auch hier zeigt sich: Wer im nachhaltigen Gewand auftritt, muss sich an den eigenen Ansprüchen messen lassen – und scheitert, wenn Rechtsgrundlagen missachtet werden.
Fazit
Der Versuch, unter dem Deckmantel des Lauterkeitsrechts unberechtigte Ansprüche durchzusetzen, ist gescheitert – mit weitreichenden finanziellen und möglicherweise auch reputativen Folgen. Das Urteil ist ein wichtiges Signal für mehr Sachlichkeit und Rechtsklarheit im Wettbewerb um zukunftsweisende Technologien.
(Offenlegung: LHR hat die Klägerin vertreten.)