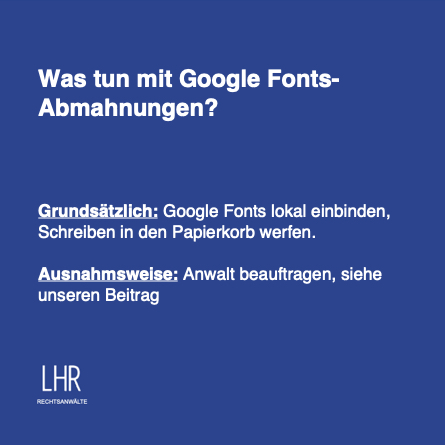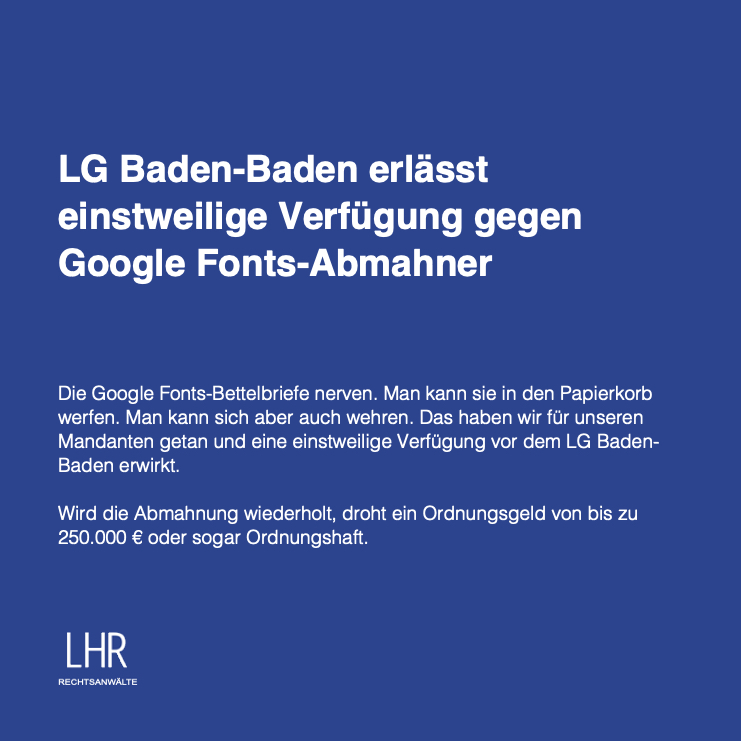Betrugsvorwürfe gegen Influencer: LHR erwirkt einstweilige Verfügung gegen Google-Suchergebnis vor dem OLG Frankfurt

Der Fall zeigt, dass sich der Kampf gegen Suchmaschinenbetreiber lohnen kann – gerade weil sie, anders als andere Täter, rational handeln und rechtswidrige Inhalte – jedenfalls nach einer gerichtlichen Inanspruchnahme – nachhaltig löschen.
Der Fall: Rufschädigung durch falsche Google-Treffer
In einem Google-Hilfe-Forum verbreitete ein Nutzer die falsche Behauptung, renommierte Medien hätten das Geschäftsmodell des Antragstellers als „Betrug“ bezeichnet. Google weigerte sich zunächst, die Inhalte aus seinen Suchergebnissen zu entfernen. Der Betroffene zog daraufhin mit LHR vor Gericht – mit Erfolg.
Google scheitert mit haltlosen Gegenargumenten
In dem Verfahren versuchte Google mit mehreren, teils absurden Argumenten die Löschung zu verhindern:
- Es sei nur eine Meinungsäußerung – Das Gericht stellte klar, dass die Behauptung, renommierte Medien hätten „Betrug“ geschrieben, eine überprüfbare Tatsachenbehauptung ist – und diese war nachweislich falsch.
- Es gebe ein öffentliches Interesse an den Vorwürfen – Das Gericht wies darauf hin, dass es für ein „öffentliches Interesse“ an einer unwahren Tatsachenbehauptung keine Grundlage gibt.
- Google sei gar nicht verantwortlich – Die Richter stellten unmissverständlich klar, dass Suchmaschinenbetreiber spätestens nach Kenntnis einer Rechtsverletzung zum Handeln verpflichtet sind.
Warum der Weg über Google oft strategisch klüger ist
Der Fall zeigt: Es kann effektiver sein, gegen Google statt gegen die eigentlichen Verfasser solcher Inhalte vorzugehen.
Google löscht vollständig
Suchmaschinenbetreiber haben keinen Einfluss auf die Inhalte der ursprünglichen Quelle. Wird ein Eintrag aus den Suchergebnissen entfernt, ist er für die meisten Nutzer unsichtbar. Dies unterscheidet sich fundamental von einer Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Verfasser, der den Inhalt oft einfach umformulieren oder an anderer Stelle erneut hochladen kann. Während eine Google-Löschung eine dauerhafte Entfernung aus dem sichtbaren Internet bedeutet, bleibt bei einer direkten Konfrontation mit dem Täter das Risiko bestehen, dass der Beitrag in leicht abgeänderter Form wieder auftaucht.
Zwar versucht Google zunächst oft mit standardisierten Ablehnungsschreiben oder teils abwegigen Argumenten eine Löschung zu verhindern, um dem Eindruck entgegenzuwirken, es reagiere auf Zuruf. Doch sobald die Rechtslage klar ist, entfernt das Unternehmen die betroffenen Inhalte in der Regel dauerhaft und nachhaltig.
Google handelt (meist) rational
Täter, die diffamierende Inhalte veröffentlichen, handeln oft emotional und verteidigen ihre Aussagen verbissen. Manche nutzen die Auseinandersetzung sogar als Vorwand, um weitere Angriffe zu starten. Wer sich auf eine direkte Konfrontation mit dem Verfasser einlässt, läuft Gefahr, dass dieser gezielt neue negative Inhalte veröffentlicht und die Auseinandersetzung eskaliert.
Google hingegen verfolgt keine persönlichen Interessen und löscht nach klaren rechtlichen Kriterien – oft dauerhaft und effizient. Auch wenn sich Google anfangs mit Händen und Füßen wehrt, um seinen eigenen Ruf als neutraler Plattformbetreiber zu schützen, agiert das Unternehmen letztlich berechenbar.
Sobald eine Rechtsverletzung eindeutig nachgewiesen ist, entfernt Google die entsprechenden Suchergebnisse – anders als ein emotional aufgebrachter Täter, der oft eher zur Eskalation als zur Einsicht neigt.
OLG Frankfurt: Klare Pflichten für Suchmaschinenbetreiber
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat deutlich gemacht, dass Google in solchen Fällen nicht einfach untätig bleiben kann. Spätestens nach einem Hinweis auf eine Rechtsverletzung ist das Unternehmen verpflichtet, Suchergebnisse mit unwahren Tatsachenbehauptungen zu entfernen.
Fazit: Wer sich wehrt, kann gewinnen
Die Entscheidung zeigt, dass Betroffene sich nicht mit rufschädigenden Google-Treffern abfinden müssen. Auch gegen mächtige Plattformen wie Google lohnt sich der Rechtsweg – gerade weil sie an Recht und Gesetz gebunden sind und keine emotionalen Motive verfolgen.