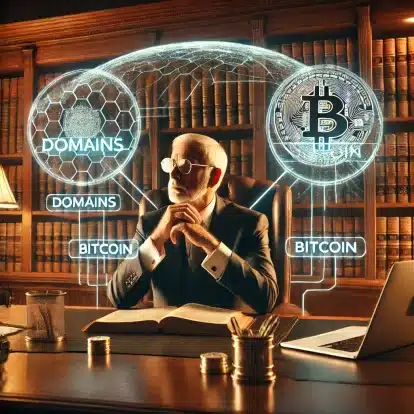In einer zunehmend digitalisierten Welt hinterlassen wir nicht mehr nur physische Besitztümer, sondern auch zahlreiche digitale Spuren. E-Mail-Konten, Social-Media-Profile, digitale Abonnements und sogar Kryptowährungen sind Teil unseres modernen Nachlasses. Doch was passiert mit diesen digitalen Vermögenswerten nach dem Tod? Wer erhält Zugriff auf Online-Konten und gespeicherte Daten? Und welche rechtlichen Herausforderungen ergeben sich für Erben?
Während das klassische Erbrecht weitgehend klar geregelt ist, wirft der digitale Nachlass noch viele Fragen auf. Große Internetplattformen haben eigene Bestimmungen zum Umgang mit den Daten Verstorbener, die nicht immer mit dem geltenden Erbrecht übereinstimmen. Ohne frühzeitige Vorsorge kann es für Angehörige schwierig sein, den digitalen Nachlass zu verwalten oder überhaupt darauf zuzugreifen.
Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Aspekte des digitalen Erbes: Was genau vererbt wird, welche Rechte und Pflichten Erben übernehmen und welche Möglichkeiten es gibt, den digitalen Nachlass rechtzeitig zu regeln.
Übersicht
1. Was bedeutet Erbe allgemein?
Das Erbe umfasst alle Vermögenswerte, Verpflichtungen und Rechte, die eine verstorbene Person hinterlässt. Grundsätzlich unterteilt sich das Erbe in materielle und immaterielle Güter. Materielle Güter sind körperliche Gegenstände wie beispielsweise Immobilien, Geld oder Wertgegenstände, während immaterielle Güter nicht-körperliche Güter wie unter anderem Lizenzen, Patente und Rechte an kreativen Werken umfassen.
Im deutschen Erbrecht geht das gesamte Erbe im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben über. Wer Erbe wird, ist gesetzlich geregelt, sofern der Verstorbene kein Testament hinterlassen hat. In erster Linie erben nahe Verwandte wie Ehepartner, Kinder oder Eltern, danach folgen weitere Familienangehörige.
Das digitale Erbe ist ein verhältnismäßig neuer Bereich des Erbrechts, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Doch was genau ist darunter zu verstehen?
2. Der digitale Nachlass und das digitale Erbe
In diesem Zusammenhang werden oft die Begriffe „digitaler Nachlass“ und „digitales Erbe“ verwendet. Doch was genau bedeuten sie, und worin besteht der Unterschied?
Was ist der digitale Nachlass?
Der digitale Nachlass umfasst alle digitalen Spuren, die eine Person zu Lebzeiten hinterlässt. Dazu gehören sowohl persönliche als auch geschäftliche Daten, Online-Konten und digitale Besitztümer. Konkret zählen hierzu:
- E-Mail- und Social-Media-Konten (z. B. Facebook, Instagram, X (vorher: Twitter))
- Cloud-Speicher und Online-Dokumente (z. B. Google Drive, Dropbox)
- Digitale Abonnements (Streaming-Dienste, Zeitungen, Softwarelizenzen)
- Online-Banking und PayPal-Konten
- Kryptowährungen und digitale Zahlungsmittel
- Online-Shops und Mitgliedschaften (z. B. Amazon, eBay, digitale Kundenkonten)
- Persönliche digitale Daten wie Fotos, Videos und Dokumente
- Webseiten, Blogs oder digitale Projekte
Der digitale Nachlass bezieht sich somit auf die Gesamtheit aller digitalen Vermögenswerte und Daten einer verstorbenen Person, unabhängig davon, ob diese vererbbar sind oder nicht.
Der digitale Nachlass umfasst sowohl wertvolle als auch alltägliche digitale Besitztümer, unabhängig davon, ob sie rechtlich oder finanziell relevant sind.
Was ist das digitale Erbe?
Das digitale Erbe hingegen ist ein spezifischer Teil des digitalen Nachlasses, der tatsächlich vererbt werden kann. Hierbei geht es vor allem um rechtlich relevante und wertvolle digitale Inhalte. Dazu gehören insbesondere:
- Finanzielle Vermögenswerte wie Online-Bankkonten, Kryptowährungen und digitale Wertpapiere
- Urheberrechtlich geschützte digitale Werke (z. B. E-Books, Musik, Fotografien, Software)
- Monetarisierte Websites, Blogs oder Social-Media-Konten
- Lizenzen oder Nutzungsrechte an digitalen Gütern
Das digitale Erbe wird, ähnlich wie das physische Erbe, durch Erbrechtsregelungen bestimmt und kann an Erben weitergegeben werden. In vielen Fällen muss dafür ein Testament oder eine spezielle Regelung getroffen werden, da viele Plattformen unterschiedliche Richtlinien für den Zugang zu Konten verstorbener Nutzer haben.
3. Wer erbt das digitale Erbe?
Rechtlich betrachtet gehört das digitale Erbe zur Gesamtrechtsnachfolge, genau wie physische Vermögenswerte. Das bedeutet, dass Erben nicht nur Eigentum, sondern auch alle Rechte und Pflichten des Verstorbenen übernehmen. Dazu zählen unter anderem offene Rechnungen von Online-Diensten sowie Vertragsverpflichtungen.
Ein bedeutender rechtlicher Streitpunkt ist, ob Erben automatisch Zugang zu den Online-Konten des Verstorbenen erhalten. Das Facebook-Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12. Juli 2018 (Az. III ZR 183/17) brachte Klarheit: Erben haben das Recht auf den digitalen Nachlass und dürfen auf Social-Media-Konten zugreifen. In einem ähnlichen Urteil verpflichtete das Landgericht Münster Apple dazu, Erben Zugang zur iCloud zu gewähren (Az. 014 O 565/18).
4. Die Übertragung von Domains und Social Media nach dem Erbfall
Domains als Teil des digitalen Erbes
Besitzt eine verstorbene Person eine eigene Website oder registrierte Domains, stellt sich die Frage nach deren Übertragbarkeit. Domains gelten als immaterielle Güter mit wirtschaftlichem Wert. In Deutschland gilt, dass Domains vererbbar sind und auf Erben übertragen werden können.
Die praktische Umsetzung der Übertragung erfordert:
- Den Nachweis der Erbberechtigung gegenüber der Registrierungsstelle (z. B. DENIC für .de-Domains).
- Die Entscheidung, ob die Domain weiter betrieben, verkauft oder gekündigt werden soll.
- Die Klärung etwaiger laufender Verpflichtungen aus Webhosting-Verträgen.
Es empfiehlt sich, bereits zu Lebzeiten eine Regelung für die Verwaltung und Weitergabe von Domains zu treffen, um den Erben mögliche rechtliche Hürden zu ersparen.
Social-Media-Konten und deren rechtliche Problematik
Viele Social-Media-Plattformen haben eigene Regelungen für den Umgang mit den Konten verstorbener Nutzer:
- Facebook bietet an, ein Konto in den „Gedenkstatus“ zu versetzen oder es durch eine vorher benannte Vertrauensperson löschen zu lassen.
- Instagram verfährt ähnlich und erlaubt es engen Angehörigen, Konten zu entfernen oder zu gedenken.
- Google ermöglicht es Nutzern, über einen „Inaktivitäts-Manager“ festzulegen, was mit ihren Daten nach dem Tod geschieht.
- X (Vorher: Twitter) erlaubt derzeit nur das Löschen von Konten nach Vorlage eines Todesnachweises, gewährt aber keinen Zugriff auf die Inhalte.
5. Fazit: Wie kann man sein digitales Erbe regeln?
Da das digitale Erbe oft nicht automatisch in klassischen Testamenten geregelt ist, empfiehlt sich eine bewusste Planung. Dazu gehören:
- Auflistung aller relevanten digitalen Konten, Passwörter und Lizenzen
- Festlegung einer Vertrauensperson, die Zugang zu diesen Daten erhalten soll
- Klare Anweisungen im Testament oder in einer digitalen Vorsorgeverfügung zur Verwaltung oder Löschung der Daten
- Nutzung von digitalen Nachlassdiensten, die den Zugriff für Erben erleichtern
Letztendlich ist das digitale Erbe ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt und rechtlich noch nicht vollständig geklärt ist. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit diesem Thema hilft, Konflikte zu vermeiden und den digitalen Nachlass nach eigenen Wünschen zu regeln.